Kritiken
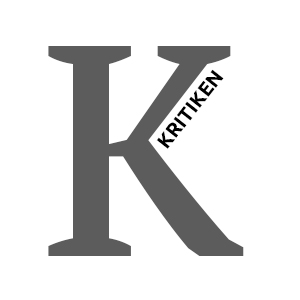
- Schmäh in Schräglage
Schmäh in Schräglage
Der Wiener Schlawiner Voodoo Jürgens pflegt eine subkulturelle Songkunst zwischen Tod und Leben
Der dunkle Anzug hängt kantig um den dünnen Körper, die blonde Vorne-kurz-hinten-länger-Frisur zottelt ums bubenhafte Gesicht, die Zuhälterkette glitzert am aufgeknöpften Kragen des Siebziger-Jahre-Hemds. Mit einer gossenhaften Grandezza kommt er daher, dieser Wiener Schlawiner, der sich Voodoo Jürgens nennt und stilsicher zwischen Schmäh von Schmach bewegt. Oder, um mit zwei Kernaussagen auf seiner aufkleberübersäten Akustikgitarre zu sprechen: zwischen „Fettkakao“ und „Nein“.
Mit viel Schmiss stimmen Voodoo Jürgens und seine vierköpfige Band „Die Ansa Panier“ am Montagabend in der nur spärlich gefüllten Centralstationshalle das Stück des Debütalbums „Ansa Woar“ an, mit dem Jürgens voriges Jahr einen Hit gelandet hat. „Heite grob ma Tote aus“ ist eine munter hin- und herschwankende Nummer. Das Ausgraben von Leichen beschwört sie mehr sinnbildlich als einen Akt, das Abseitige zu zelebrieren.
Passend dazu wird die Hookline unprätentiös mit einer Melodika in Schräglage geblasen.
Außer der packenden Taktung und Melodik ist es wohl auch der hier relativ gut verstehbare Text, der die Nummer griffig macht. „Des is‘ wie bei ‘em Eros-Ramazotti-Konzert“, hat der 34 Jahre alte Voodoo Jürgens alias David Öllerer schon zum Auftakt des Konzerts gewitzelt angesichts seines hierzulande kaum verstehbaren Tiefenwienerischs. Und trotzdem kann man manchmal mitsingen, zum Beispiel den Refrain des Hits, als das Publikum der Aufforderung des charmanten Frontwieners folgt: „Den Text kennt’s jetzt, singt’s a Rund‘ mit mir.“Musikalisch wird Voodoo Jürgens gern dem Austropop zugeschrieben, den seit einigen Jahren österreichische Bands wie Wanda neu aufleben lassen. Mit ihnen ist er durchaus verbandelt und wurde auch schon als das nächste große Ding dieses Pop-Hypes gehandelt. Doch Voodoo Jürgens ist mehr als das. Das Schlagerhafte trägt er mehr als Zerrbild in seinem Namen, frech entlehnt von dem gerade in Deutschland als Schlagerstar verehrten, verstorbenen Österreicher Udo Jürgens.
Doch musikalisch bewegt er sich eher in der österreichischen Tradition des Morbiden: Mit bitterschwarzem Humor und einer sprachintensiven Detail- und Typenverliebtheit begibt sich der 34 Jahre alte Liedermacher und Songpoet mit bürgerlichem Namen David Öllerer an die Ränder der Gesellschaft, wo er selbst in Teilen aufgewachsen ist. „Zwischen Zuckerbude und Kadaverfabrik“ besingt er die Kindheit in der Geburtsstadt Tulln, in „Nochborskinda“ einen prügelnden Vater, in „Hansi Da Boxer“ eine Sechziger-Jahre-Kämpferlegende.
Voodoo Jürgens schlüpft in diese Figuren und ist mundsprachlich so nah bei ihnen, dass es eine wahre Pracht ist. Die Worte entfalten selbst dann Wucht, wenn man sie nicht versteht. Gehässig zieht er Vokale in die Länge, angriffslustig rollt er das R, ein säuseliger Ton wechselt mit eruptiven Tiraden. Mal klingt er rau wie Tom Waits, rezitierend wie Bob Dylan, sarkastisch wie Landsmann Georg Kreisler und auch mal quirlig wie die Wienerin Cissy Kraner. Das ist nicht Schlager, das ist Kleinkunst zwischen Leben und Tod.
Die subkulturelle Anmutung wird mitgetragen von einer Instrumentierung, die mehr akustisch als poppig daherkommt mit Kontrabass, Akkordeon, Geige, Keyboard und einem oft reduzierten Schlagzeug. Der Sound ist dunkel und warm, die Taktung oft schlendernd. Das passt gut zur matten Melodramatik, die Voodoo Jürgens auch gestenreich übermittelt. Immer wieder beugt er den Körper im Vortragsrausch vorn über und macht mit dem rechten Arm eine weit ausholende Bewegung. Es ist, als mache er einen Diener vor den Worten. Und den macht er am Ende auch vorm Publikum. Denn galant ist der Schlawiner auch.
- Soul ohne Seele
Soul ohne Seele
Curtis Harding reitet auf dem Retro-Soul-Zug, aber das hinter seiner Sonnenbrille weitgehend unterkühlt und blutleer
Es fing schon an mit der Sonnenbrille. Die Augen gelten ja gemeinhin als Fenster zur Seele. Da kann es irritieren, wenn ein Soulsänger sie hinter abgedunkeltem Glas versteckt – pflegt er doch ein Musikgenre, das den Seelenstriptease schon im Namen trägt. „Nimm die Sonnenbrille ab“, rief dann auch jemand kurz nach Beginn des Konzerts aus dem Publikum hoch zu Curtis Harding und dessen glitzergeränderter Sonnenbrille. Doch der reagierte erbost: Es gehe hier um Musik und nicht um Optik, empörte er sich – und überhaupt, so setzte er nach dem nächsten Song nach: „Sag mir nicht, was ich tun soll!“
Etwas fast Unterkühltes hatte das Geschehen auf der Bühne am Dienstagabend in der Centralstation von Anfang an. Und das lag nicht nur an den Sonnenbrillen, die Harding und zwei seiner vier Mitmusiker zur Schau trugen. Relativ statisch agierte die Band in klassischer Besetzung an Gitarre, Bass, Schlagzeug und Synthesizer beziehungsweise Saxophon auf der Bühne, da wurde kaum eine Miene verzogen. Und der 39 Jahre alte Frontmann und Sänger schien nur bei seinen bewegteren Retrosoul-Stücken warmzulaufen: Als lege sich ein Schalter um, tänzelte er da, munter ein Tamburin schlagend, umher.
Nun gibt es ja glücklicherweise keine Vorschrift für angemessenes Agieren auf einer Konzertbühne – das kann jeder halten, wie er will. Natürlich steht, da hat Harding völlig Recht, die Musik im Vordergrund. Und die Musiker, die auf der Bühne zusammenspielten, waren allesamt Profis ihrer Disziplinen – ganz zu schweigen von Curtis Harding und seiner hervorstechenden Stimme, in bestem Soulsinne posaunend und sonnengereift. Aber für ein Musikgenre, in dem es im Kern immer um Hingabe geht, war der Auftritt irritierend blutleer. Da hat der junge Support-Act Jeangu Macrooy mit seinem herzerweichenden Gesang mehr Leidenschaft an den Tag gelegt.
Curtis Harding ist keinesfalls von Grund auf Soulmusiker. Erst mit seinem Debütalbum 2014 (Soul Power) ist auch er auf den Retro-Zug aufgesprungen, der seit ein paar Jahren erfolgreich durch die Popwelt rollt. Zuvor war der Sohn einer Gospelsängerin eher im Hip-Hop und Rap unterwegs und später auch im Rhythm and Blues oder Garage-Rock. Und viele dieser Einflüsse fließen in seinem Stil ein.
Live in der Centralstation klang der Sound über weite Strecken sehr voll und bis in jede Schwingung gesättigt. Über groovige und verspielte Bassläufe und treibende Schlagzeugbeats legten sich flirrende Gitarren- und synthetische Keyboardlinien, das mutete teils an wie Psychedelic-Pop. Und Hardings Stimme war dazu mit so viel Hall aufgeladen, dass sie wie gasförmig durch den gut gefüllten Saal strömte. Leider verflüchtigte sie sich dabei aber auch in dem sphärischen Sound, dem es vor allem anfangs an Konturen fehlte.
Packender gerieten die Stücke im Stil des Retro-Soul, die pointierter und weniger füllig arrangiert waren – allen voran der hervorstechend lebendige Hit „I Need Your Love“ am Ende des Programms. Nach genau einer Stunde verließ Curtis Harding die Bühne. Dass er dann gar keine Zugabe mehr spielte, sorgte im Publikum für Enttäuschung, teils auch Empörung. Aber er wollte wahrscheinlich nichts machen, was von ihm verlangt wird. Auch die Sonnenbrille behielt er die ganze Show auf.
- Gesichter, die Bände sprechen
Gesichter, die Bände sprechen
Berliner Gropius-Bau zeigt in einer Retrospektive Richard Avedons Kunst und Handwerk der Fotografie
Manchmal ist ein Porträt gerade deshalb besonders aufregend, weil gar kein Gesicht zu sehen ist. Da lenkt ein Frauenbein die Aufmerksamkeit des Betrachters ganz auf sich, eine schlanke Fessel ragt aus dem dunklen Pelzrand eines hochhackigen, geschlossenen Damenschuhs in Schwarz. Man sieht das blanke Bein nicht mal hoch bis zum Knie, der obere Teil ist von einem Pelzmantel verdeckt. Und dennoch ergibt sich das Bild einer Frau – die sich edel kleidet, die eine mondäne Strenge umgibt und die mit weitem Schritt schreitet über den Platz vor dem Eiffelturm, der nur schemenhaft im Hintergrund auftaucht.
Es ist interessant, dass ausgerechnet dieses Foto einer Extremität den Auftakt bildet zu der ersten deutschen Retrospektive des großen Schwarz-Weiß-Fotografen Richard Avedon im Berliner Martin-Gropius-Bau. Denn ansonsten ist es eine Schau der Gesichter. Nur einmal noch ein Porträt kopflos daher – und bezieht auch hier gerade daraus besondere Wirkung: Es zeigt einen nackten Männeroberkörper mit brutalen Einstichverletzungen, wulstige Narben ziehen sich quer über den Rumpf. Dass es der geschundene Körper von Andy Warhol ist, der einst Opfer einer Messerattacke wurde, verrät erst der Text. Zuvor dachte man allenfalls an einen Niemand, wie ja Opfer leider viel zu oft Nobodies sind.
Ob nun mit Kopf oder ohne: Richard Avedon, 1923 in New York geboren, 2004 in Texas gestorben und dazwischen sechzig Jahre lang schon zu Lebzeiten einer der bedeutendsten Menschen- und Modefotografen, macht das Objekt zum Subjekt. Das gilt schon für seine frühe Modefotografie ab 1946, mit der die chronologisch gehängte Schau von mehr als zweihundert seiner Werke beginnt.
Der Fotograf haucht Models und Mode Leben ein, indem er sie in Bewegung zeigt, auf den Straßen oder im Nachtleben von Paris. Es ist eine szenische Modefotografie, die Stoffe fließen und Haare fliegen lässt und Models erhebt über eine reine Objektfunktion hin zur Filmrolle.
Fast bahnbrechend in der Welt perfekter Inszenierung perfekter Frauen in perfekten Kleidern: sein Verzicht auf Kunstlicht. Bevor Avedon in den fünfziger Jahren die Models in den atemberaubenden Roben von Dior und Co. in den Pariser Studios der Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“ ablichtete, riss er Fensterverkleidungen herunter und fotografierte die edel gekleideten Damen dann bei Oberlicht vor einem dunkelstumpfen Stück Stoff, das am Rande ausfranselt und Wellen schlägt.
Es ist oft kompositorischer Bestandteil von Avedons Fotokunst, dass man ihr das Handwerk ansieht. Da ist die notdürftige Art, mit der ein Hintergrundstoff festgepinnt wurde, Teil der Inszenierung. Typisch Avedon sind auch die schwarzen Rahmen um seine Porträts, die den Belichtungsvorgang beim Abziehen auf Fotopapier dokumentieren. Überhaupt offenbaren seine Bilder eine Experimentierfreude, die jedoch nicht zu verspielt, sondern angemessen eingesetzt wird – vom grobkörnigen Einfangen einer verwehten Strandszene bis zum aufwühlenden Wahnsinnseffekt, den eine lange Belichtungszeit in einem geschüttelten Tanzlehrer-Gesicht hinterlässt.
Auch routinierte Posierer wirken ehrlich
Doch starke Spannung entwickeln die Porträts, die den Fokus ganz und klar auf den Menschen legen, wenn kein Dahinter oder Daneben ablenkt. Das wirkt pur und ehrlich – sogar bei denen, die geübt sind im Posieren. Der leere Blick einer todtraurig aussehenden Marilyn Monroe (1957) erweckt hier fast den Eindruck, Avedon habe sie in einem unbeobachteten Moment erwischt.
Salman Rushdie (1994) gewährt tiefen Einblick in satanische Augen. Und Truman Capote (1974) schaut so angewidert unter seinen halbgeschlossenen Augenlidern hervor, dass einem fast vom Zusehen schlecht wird.
Besondere Perlen jedoch, gerade in der räumlichen Nähe zu all den Prominenten, sind die Menschen, die Richard Avedon von 1979 bis 1983 bei seinen Reisen durch den amerikanischen Westen vor einen weißen Hintergrund stellte: Der Lastwagenfahrer, die Kellnerin, die Physiotherapeutin zehren von der Attraktivität des Unbekannten. Da wird die Betrachtung zum Ratespiel zwischen Schein und Sein, entpuppt sich der junge Beau als Fleischpacker, die Drogenabhängige als Krankenschwester und der Regisseur als Landstreicher.
Es ist eine facettenreiche und empfehlenswerte Ausstellung im altehrwürdigen Martin-Gropius-Bau, der noch dazu eines der schönsten Museen in der Mitte Berlins ist. Die Gesichter, die Richard Avedon zeigt, sprechen Bände.